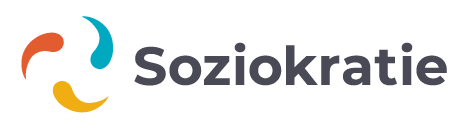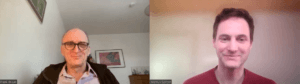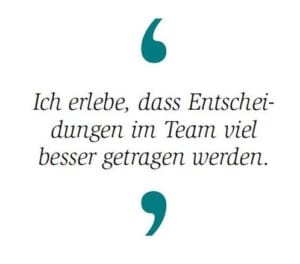Wie kann eine lokale Regierung das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen und eine neue politische Kultur schaffen, die auf Kooperation, Transparenz und Bürgerbeteiligung basiert?
Die niederländische Gemeinde Utrechtse-Heuvelrug hat genau das geschafft – durch die Einführung von soziokratischen Prinzipien in ihrem Gemeinderat.
Erfahre, wie ein innovatives Pilotprojekt mit dem „BOB“-Modell nicht nur zu mehr Akzeptanz und effizienteren Entscheidungen geführt hat, sondern auch eine stärkere Bürgerbeteiligung ermöglichte. Seit 2014 hat sich dieses Modell bewährt und die politische Landschaft nachhaltig verändert.
- Die Umgestaltung der Kommunalpolitik durch soziokratische Prinzipien.
- Konkrete Schritte zur Förderung von Bürgerbeteiligung und Kooperation.
- Den messbaren Erfolg in Form von höherem Vertrauen, besserer Zusammenarbeit und wachsender Wahlbeteiligung.
Entdecke, wie diese Transformation auch für andere politische Gremien wegweisend sein könnte:
Soziokratie im Gemeinderat UH_Deutsch_kurzDipl.-Ing. Dr. Rita Mayrhofer